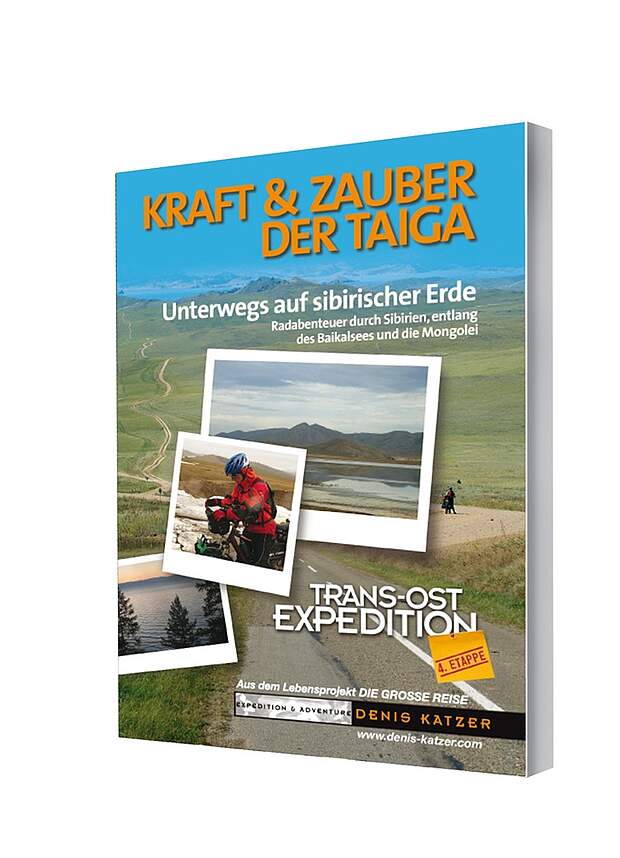Vom Bodensee in die Mongolei
Im Rahmen ihrer 30jährigen Expedition, der längsten dokumentierten Expedition der Geschichte, „Die große Reise“ begann für Tanja und Denis Katzer am Bodensee ein neues Abenteuer. Ihre Route: 15.000 km mit dem Fahrrad von Deutschland nach Österreich, über die Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien, Moldawien, Ukraine, Russland, Kasachstan, Sibirien und die Mongolei.
Ein Tag in Sibirien
Der Tacho zeigt erst 17 Tageskilometer an, als sich ein Alptraum unter unseren Rädern manifestiert. Schon von weitem haben wir die heftigen Staubfahnen in den mit leichten Schäfchenwolken betupften Himmel aufsteigen sehen. Kaum rollen unsere Reifen vom letzten Zentimeter des glatten Bitumens, beginnt es kräftig zu holpern. Es dauert nicht lange, und unsere Nacken und Schultern verspannen sich. Nach fünf Kilometern und über einer Stunde später, beginnen meine Ellenbogen Signale zu senden. Und das obwohl wir voll gefederte Räder besitzen. Unsere Taschen, die Kameras, Laptop und Satphon werden so gewaltig durchgerüttelt, dass es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis irgendetwas davon den Geist aufgibt. Unerklärlicherweise herrscht gerade auf diesem Abschnitt extrem viel Verkehr. Vielleicht liegt es an den Lastwagen, die sich mit maximal 10 Km/h pro Stunde über den Acker quälen und die Pkws aufhalten. Alle paar Kilometer bleibt ein Fahrzeug am Straßenrand liegen. Reifen werden gewechselt, die den zum Teil spitzen Steinen nicht Stand halten konnten. Der feine, aufgewirbelte Staub vermindert die Sicht. Fast alle der Pkws rattern in unverminderter Geschwindigkeit an uns vorbei. Steine werden durch die Reifen aufgewirbelt und schlagen gegen unseren Rahmen oder Felgen. Wir husten und spucken. Trinken ständig Wasser. Das Thermometer zeigt 31° C, in der Sonne 54 °C. Wir schwitzen und konzentrieren uns. Dürfen keinen Fehler machen, denn schnell kommt man bei nur vier bis fünf Stundenkilometer Geschwindigkeit ins Wanken. Die Rohloffschaltung wird bis zum Äußersten gefordert. Meine rechte Hand dreht ständig am Schaltgriff. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, dann wieder in den Ersten. So geht es rauf und runter. Würde uns die zuverlässige Schaltung hier im Stich lassen, wäre die Reise zu Ende. Ohne eine Schaltmöglichkeit gäbe es keine Sibiriendurchquerung. Wieder geht es den Berg hoch. Wir malträtieren erneut die Rohloff. Es klackt zuverlässig und ich bin im Ersten. Dann geht nichts mehr. Der Hinterreifen dreht durch. Schnell absteigen bevor mein schweres Ross kippt! Die Lungen atmen den vielen Staub ein und funktionieren trotzdem prächtig. Mein Herz pumpt wie wild. „Wie schön ist es einen gesunden, leistungsfähigen Körper zu besitzen“, geht es mir durch den Kopf. Hochleistung pur ist angesagt. Ein Ende ist zu dieser Sekunde nicht in Sicht. Weiter geht's, immer weiter. In den Sattel, ein paar Meter kurbeln und wieder runter. Die Füße in den Staub und auf die Steine. Die Beinmuskulatur pumpt sich auf. Wie so oft auf dem Trip glaube ich, zwei mächtige Brückenpfeiler unter mir zu spüren. Meine Beine sind meine Freunde. Jeder Körperteil ist wichtig, nichts darf versagen. Die Arme und Hände schieben und drücken, der Atem rasselt, der Kopf ist leer. Die Anstrengung beendet das ewige Denken. Ruhe herrscht in der Birne. Absolute Stille. Es kommt nur darauf an weiterzukommen. Es kann ja nicht ewig dauern. Irgendwann einmal hört der schlimmste Alptraum auf. Irgendwann einmal, vielleicht schon heute Abend, schenke ich diesem tollen Körper ein kühles Bier. Wer weiß, was der Tag noch bringen wird? Wie soll ich wissen, was auf mich noch zukommt? Es geht weiter. „Poch, poch, poch“, höre ich es in meiner Brust klopfen. Die Pumpe arbeitet zuverlässig. Es rattert und schabt an uns vorbei. Tanja ist teilweise vor oder hinter mir. Auch sie denkt oder denkt nicht in diesem Moment. Auch sie schiebt und tritt ihr Intercontinental. Auch sie lässt die Rohloff die Gänge rauf und runter surren. Ihre Waden blasen sich ebenfalls auf und ihr Atem hechelt neben mir. Wir sehen uns durch den Staub kurz an. Genug Kraft für ein kurzes zuversichtliches Lächeln. Das Leben ist schön. Wir leben es pur. Auch wenn es ab und an anstrengend ist, jedoch werden wir dafür immer und ohne Ausnahme belohnt. Augenblicke wie diese gehören dazu. Sind wichtig. Erden uns. Zeigen uns, was wir leisten können und was das Wort „Abenteuer“ bedeutet. Ein Wort, welches mit Romantik kaum etwas zu tun hat, sondern eher mit einer nackten, unausweichlichen Realität.
Die letzten 12.000 Radkilometer haben uns bewusst werden lassen das es nicht selbstverständlich ist, dass jeder, der sich aufs Rad schwingt, auch sein Ziel erreicht. Auf der Insel Olchon (Baikalsee) trafen wir den Burjaten, dem man sein Rad gestohlen hatte. Erst gestern machten wir die Bekanntschaft mit einem jungen Franzosen, dessen Bike einfach unter ihm zusammengebrochen ist. In dem Städtchen Sühbaatar (Mongolei) lernten wir zwei Schotten kennen, die mit ihren leicht bepackten Rädern von Irkutsk nach Ulan Bator unterwegs sind. Als der vordere Gepäckträger von Robs Rad gebrochen ist und den Reifen blockierte, stürzte er. Dabei knallte er in den Hinterreifen seiner Freundin, die gerade vor ihm fuhr, und riss sie ebenfalls vom Rad. Kate krachte mit dem Kopf auf den Asphalt und brach ihren Helm in zwei Teile. Gott sei Dank war nur der Helm kaputt und nicht der Kopf. Sie sind mit leichten Schürfwunden und Prellungen davongekommen.
Mit guter Vorbereitung zum Erfolg
Als ich vor Jahren unsere Radexpedition zusammenstellte, wurde ich oft belächelt. „Soviel Gepäck? Für was soll das gut sein? Ich radle leicht. Brauche all den Luxus nicht“, haben einige gesagt. Oder: „Mit den schweren Anhängern schafft ihr das nie. Unmöglich. Was macht ihr wenn Berge kommen? Ich würde die Hälfte Zuhause lassen“, hat man uns geraten. Jetzt, nach 15.000 Kilometern durch Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien, Transnistrien, Ukraine, Halbinsel Krim, Westrussland, Kasachstan, Sibirien und der Mongolei, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass wir unsere Trans-Ost-Expedition ohne unsere Ausrüstung nicht geschafft und vielleicht auch nicht überlebt hätten. Auch wenn wir trotz Topmaterial wenig Ausfälle und Reparaturen zu beklagen hatten, waren Reparaturen nötig. Sieben platte Reifen, ein zerstörter Mantel, drei Deichselbrüche, zwei Speichenbrüche, zwei ausgelaufene Reifenlager des Anhängers, unzählige lockere Schrauben, ein kaputtes Schutzblech und einiges mehr, forderten mich und unser mobiles Ersatzteillager. Aber es sind nicht nur die richtigen Ersatzteile und das perfekte Werkzeug, um jede Schraube selber öffnen zu können, sondern auch die passende Kleidung, um extreme Wetterumbrüche heile zu überstehen. Starker Regen, unmenschliche Hitze, Schnee, Wind und Sturm können jeden Radler das Leben zur Hölle werden lassen. Schnell ist der Körper und die Psyche überfordert und genau darin liegt ein großes Potential von Verletzungen und Unfällen. Nach unserer Erfahrung ist das Zeitmanagement sehr wichtig. Schnell große Strecken zurückzulegen ist nicht immer das beste Ziel. Ganz im Gegenteil ist es wichtig rechtzeitig Pausen einzulegen, um sich von den Strapazen zu erholen. Hier gilt für uns der Spruch „langsamer ist schneller“. Gute funktionelle Kleidung, Zelt, Schlafsack und eine gefriergetrocknete Nahrung haben uns oft geholfen über Nacht neue Kräfte zu tanken. Die richtige Ausrüstung zusammenzustellen bedarf Zeit und am besten ist es sie vor dem geplanten Trip unter Realbedingungen zu testen.
Am Baikalsee
Der Weg schlängelt sich wie ein staubiges, von unzähligen Bodenwellen durchzogenes Band durch Täler und über 600 Meter hohe Berge. Wüssten wir nicht, dass die Insel nicht länger als 72 Kilometer ist, wäre dieser Anblick trotz seiner umwerfenden Schönheit frustrierend.
Die feine Übersetzung meiner Rohloffnabe ist verantwortlich dafür, dass sich die Drehtkurbel in einer irren Geschwindigkeit kreisen lässt. Somit bringe ich meinen schweren Ackergaul im ersten Gang auch über extreme Steigungen auf die Rücken der nicht aufhören wollenden Hügel. Oben angekommen verschnaufe ich. Der Blick schweift in die Ferne. Überall Berge. Laut Karte erreicht die höchste Erhebung auf Olchon 1.276 Meter. Das Binnengewässer wird von hohen, stark bewaldeten Mittelgebirgen umrahmt. Zu den ausgedehntesten gehören das Baikalgebirge und das Bargusingebirge. Von meinem erhabenen Aussichtspunkt kann ich auf der uns gegenüberliegenden Seite des Sees, der auf dieser Seite der Insel auch „Kleines Meer“ und auf der östlichen Seite „Großes Meer“ genannt wird, die Westküste des Festlandes erblicken. Dort breitet sich die Taiga wie ein endloses Wellenmeer aus, um sich am Horizont zu verlieren. Die raue Felsküste, deren graues, zum Teil aber auch weißes Gestein, wird von der immergrünen Fläche der ewigen Wälder unterbrochen. Saftige, mit Blumen bewachsene Wiesen ziehen sich bis zu den Ufern und werden erst vom glasklaren Wasser des eiskalten Sees begrenzt. Fasziniert beobachte ich das Farbenspiel des Herzens Sibiriens. Herrlichstes Türkis vergeht im hellen Blau, wird von ausladenden dunkelblauen Armen unterbrochen, die sich in zackigen Formen über die in der gleißenden Sonne reflektierende Wasserfläche ziehen. Ein Schauspiel, welches das Wesen des Baikals zeigt, in dem ich die leise Sprache der Götter zu verstehen glaube.
Durch tiefen Sand
Am höchsten Punkt angekommen, befinden wir uns im Zentrum einer bezaubernden hügeligen Steppe, die uns an die Mongolei erinnert. Geringe Niederschläge und eine hohe Anzahl von Sonnenstunden haben dieses Grasland mit ihren unzähligen kleinen farbenprächtigen Blumen und betäubend riechenden Kräutern geprägt. Edelweiß und wilder Thymian mit seinen rot-violetten kleinen Blüten, der gesammelt und dem Tee zugegeben wird, strecken sich der Sonne entgegen. Wir halten inne, um zu verschnaufen und hören dem Zirpen der Grillen zu. Millionen von Heuschrecken, Käfern und Schmetterlingen zeugen vom Leben auf dieser fruchtbaren, grünen Savanne. Manchmal überraschen wir eine der hier wohnenden Zieselmäuse, die dann erschrocken, in panischer Angst, ihr Heil in der Flucht sucht. Wenige Kilometer weiter verschluckt uns ein dichter Wald. Wir kommen nur sehr langsam voran, und mit unserem Gepäck ist es beschwerlicher als wir vermutet hatten. Des Öfteren sind wir nun gezwungen zu schieben. Tiefe, vom Regen ausgewaschene Löcher, Bodenwellen, Furchen und Matsch wechseln sich mit feinem Sand und Staub ab. Unerwartet tauchen unzählige, spärlich bewachsene, geradezu mächtige Sanddünen auf. Ab diesem Zeitpunkt versinkt der Weg in tiefem Sand. Viele der Autofahrer sind gezwungen umzukehren, wollen sie nicht riskieren hier mit ihren Fahrzeugen bis zu den Achsen zu versinken. Das Weiterkommen bedeutet für uns Schwerstarbeit. Ein Pkw wird gerade von einem Jeep aus dem Dreck gezogen. Ein anderer wartet auf Hilfe, weil er nicht mehr vor- oder zurückkommt. Allradangetriebene Kleinbusse schießen dicht an uns vorbei. Sie zwingen uns, unsere schweren Böcke von der Fahrspur in noch tieferen Sand zu pressen. Einmal schaffe ich es nicht rechtzeitig. Mit großer Kraftanstrengung versuche ich gerade verzweifelt die weiche Spur zu verlassen, als ein Kleinbus auf mich zurast. Mein Vorderreifen rutscht immer wieder weg. Den Fahrer lässt das völlig kalt. Er versucht erst gar nicht zu bremsen. Nur noch wenige Meter und er fährt mich glatt über den Haufen. „Ahh!“, brülle ich entsetzt, als er in einem Abstand von zehn Zentimeter an meinem Rad vorbeirast. Nur ein kleines Schlingern im Sand und der Bus würde mich verletzten oder platt walzen. „Puh“, ächze ich und schiebe mein Rad so schnell wie möglich aus der Spur, um nicht einem anderen Vollidioten zum Opfer zu fallen. Das Material ist auf dieser Strecke aufs Extremste belastet. Die Rohloffketten schleifen teilweise durch den tiefen Sand und ziehen ihre eigene, geplagte dünne Spur. „Ob das wohl gut geht?“, überlege ich, denn es kracht und knirscht grauslich, als wir Teilstücke dieses Schreckgespensts zu radeln versuchen. „Meinst du, die Ketten halten das aus?“, fragt jetzt Tanja. „Wer weiß? Ist das erste Mal auf der gesamten Trans-Ost-Expedition, dass wir solche materialzerstörerischen Bedingungen überwinden müssen. Kann nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Zahnkränze und die Rohloffketten aufgearbeitet haben. Ich hoffe, sie halten mehr aus als wir ihnen zutrauen. Auch wenn die Insel wunderschön ist, einen Totalschaden ist sie nicht wert. Wir wollen ja noch die Mongolei erreichen und bis dahin sind es gut und gern 1.000 Kilometer“, antworte ich besorgt.
Am Reißzahn-Kap
„Dachte das Schlimmste hätten wir hinter uns?“, schnauft Tanja, während sie sich anstrengt ihren bepackten Drahtesel Meter für Meter die Steigung hoch zu bringen. Seit mehreren Kilometern geht es hauptsächlich über Wurzelgeflecht und ausgewaschene Löcher durch ein Waldstück. An manchen Stellen ist es so steil, dass wir nur mit vereinten Kräften in der Lage sind die Räder über die Hindernisse nach oben zu schieben. „Das macht doch keinen Sinn“, schimpft Tanja. „Wenn du möchtest, können wir umkehren“, biete ich ihr an, obwohl ich persönlich sehr gerne das Ende der Insel erreichen würde. „Nein, so kurz vor dem Ziel gebe ich nicht auf“, antwortet sie und drückt ihr Aluminiumgestell auf Rädern weiter über den grottenschlechten Untergrund. Am Weggrand zeugt eine gebrochene Achse davon, wie schwer es auch die Allradfahrzeuge hier haben. Auch heute hoffen wir, dass unsere Räder nicht schlapp machen. Sie sind zwar für Extrembedingungen konstruiert, aber alles hat seine Grenzen. Die Rohloffnabe bewährt sich gerade unter solchen Bedingungen unbeschreiblich gut. Schalten unter massivem Druck, und das unaufhörlich, bereitet der Nabe und ihrer Funktionalität nicht die geringsten Schwierigkeiten. Die Kette rasselt noch immer unter unangenehmen Lauten über die Zahnkränze. Aber das ist für das geschlossene Schaltsystem völlig uninteressant. Es funktioniert, im, über und auf dem Sand und Matsch. Einfach fantastisch.
Kalt erwischt
Auch der heutige Tag fordert alles was in unseren Körpern steckt. Als würden uns die mongolischen Horden folgen, fliehen wir, über zehn Stunden nach unserem Aufbruch heute Morgen, vor dem bedrohlich aussehenden Gewitter. „Wir können es schaffen!“, brülle ich, um den Wind zu übertönen. Unsere Drehkurbeln rasen in hoher Geschwindigkeit im Kreis und lassen die Rohloffkette über die Ritzel surren. Auf den Bergrücken neben uns zucken die Blitze und zerreißen mit ihrem gleißenden Licht die Wolkengebilde. Wie lange Gichtfinger ziehen sich schlauchartige Gebilde bis zum Steppenboden und zeigen, dass dort kaltes Wasser in den durstenden Boden stürzt. Der wieder erwachte Wind erhebt sein Zepter und fährt uns in die Seite. Als wäre unser Radrahmen ein Instrument aus längst vergessener Zeit, ertönt ein eigenartiger Klagelaut. „Los, schneller!“, motiviere ich uns. Meine Knie brüllen auf. Sie wollen endlich Ruhe, aber mein Geist treibt sie voran. Lässt sie wie das dampfgetriebene Antriebsgestänge einer Lok nach unten stoßen, um die geballte Kraft auf die Pedale zu übertragen. Zwei Kilometer vor Sühbaatar beginnt es zu tröpfeln. Wir halten an und reißen die Regensachen aus unseren vorderen Radtaschen. „Auch die Überschuhe!“, rufe ich Tanja zu. „Meinst du es wird so schlimm?“ „Na schau mal dort rüber!“, antworte ich, auf die Berge deutend. Schnell schieße ich mit unserer Spiegelreflex noch ein Paar Bilder, dann wird sie nass. Die Himmelsschleusen öffnen sich noch bevor ich den Reißverschluss meiner Regenjacke schließen kann. Innerhalb Sekunden befinden wir uns in einer dichten Wolkensuppe und werden Spielball der Naturgewalten. Da sind sie wieder, die mongolischen Unwetter. Als wir die Mongolei 1996 1.600 Kilometer von West nach Ost mit Pferden durchquerten, haben uns diese Gewitter das Fürchten gelehrt. Nun sind wir gerade mal 20 Kilometer im Land des Großkahns und schon werden wir vom Unwetter gebührend empfangen. Die Temperatur stürzt von ca. 26 °C in der gerade noch vom Himmel scheinenden Sonne auf vielleicht zwei Grad. Hagelkörner schlagen links und rechts, vor und hinter uns ins Gras und auf die Straße. „Plong! Plong! Plong!“, klackert es auf unseren Helmen. Die Böe packt urplötzlich mit eisigem Griff zu und versetzt unsere Räder einen oder zwei Meter in die Straßenmitte. Gott sei Dank gibt es hier wenig Autos. Wir rollen einen Hügel zum Ort herunter. Hinter einem verfallenen Steinhäuschen suchen wir Schutz vor den heranpeitschenden Böen. „Puh!“, bläst Tanja erleichtert. In den Stromkabeln über uns surrt es laut. Nur wenige Minuten nachdem unsere Körper zur Ruhe gekommen sind, beginnen wir zu frieren. Der eisige Atem des Windes lässt uns erahnen, was es heißen mag hier im Norden des Landes minus 50 °C im Winter ertragen zu müssen. „Es macht keinen Sinn zu warten. Der Sturm wird noch eine Weile anhalten“, glaube ich, weswegen wir uns wieder auf den nassen Sattel schwingen und weiter in das eiskalte Getöse radeln. Wettergeprüfte Menschen kommen uns entgegen. Sie laufen am Straßenrand und stemmen sich gegen den aggressiven Sturm. Es kommt uns so vor, als würde er seinen gesamten Ärger herausbrüllen uns erst jetzt entdeckt zu haben…
Auszüge aus dem Buch: Kraft und Zauber der Taiga